Eminem und „Revival“: Ein Manifest der Irrelevanz
29.12.2017 | Julius Krämer
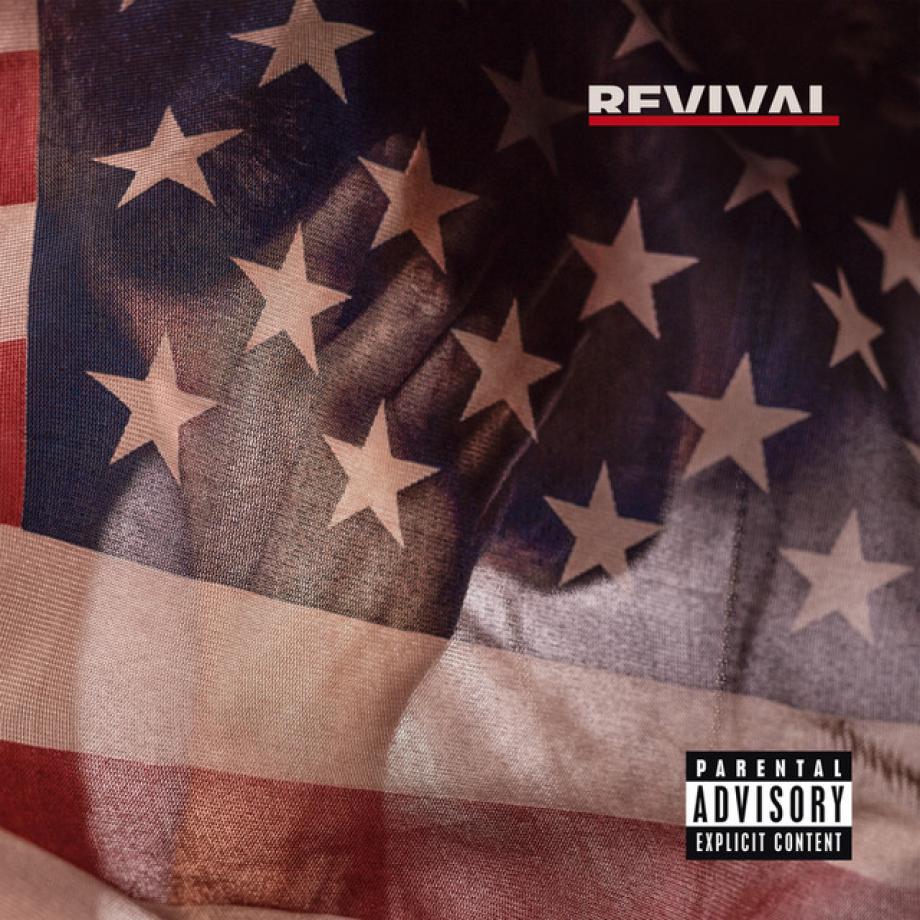
Ende 2017 ist Rap vielleicht am bisherigen Zenit seines Schaffens angekommen. Denn obwohl nicht wenige HipHop-Romantiker immer noch den guten alten Zeiten von 2Pac und Biggie nachtrauern, gibt es mittlerweile eine solche Fülle an Subgenres und Bewegungen, die allesamt nebeneinander koexistieren können, kommerziell erfolgreicher denn je sind und künstlerisch genreübergreifend die neuen Impulse und Trends setzen: Trap und Cloud Rap überschwemmen mit reichlich Verspätung sogar die deutschen Charts, Vordenker wie Kanye West polarisieren wie eh und je und auf Rap-Messias Kendrick Lamar kann sich ob seiner gelungenen Verknüpfung von zeitgemäßen Strömungen und Jazz so ziemlich jeder einigen. Ein Ende ist nicht in Sicht.
Doch welchen Platz hat die doch so erfolgreiche und vielseitige Szene für HipHops Elder Statesman, Eminem? Derjenige, der vor knapp 20 Jahren das Genre endgültig in den Mainstream katapultierte und nicht zuletzt auch einer riesigen weißen Hörerschaft eröffnete – ohne jemals an Kredibilität oder Ansehen seitens der HipHop-Community zu verlieren. Nun waren sein letztes Album „Marshall Mathers LP 2“ (2013) sowie sein Comeback „Recovery“ (2010) zwar weit von Meilensteinen wie „Marshall Mathers LP“ (2000) entfernt, sie enthielten jedoch zahlreiche gute bis solide Songs und konnten sich trotz einiger fragwürdiger Produktionen und Radiopop-Songs hören lassen. Ohne sich an den Zeitgeist anzubiedern oder gestrig zu wirken schaffte es Eminem zumindest, einen gewissen Standard aufrecht zu erhalten, auch wenn er vergeblich seiner Relevanz vom Anfang des Jahrtausends hinterher lief – der Mann war schließlich der kommerziell erfolgreichste Künstler der 2000er. Dr. Dres überraschendes erstes Album nach 16 Jahren, „Compton“, zeigte darüber hinaus auf „Medicine Man“ einen Eminem in Höchstform: technisch versiert, leidenschaftlich, und mit der Zeile „I even make the bitches I rape cum“ wieder unerwartet provokant. In 96 Sekunden machte er jeden Zweifel an möglichen Alterserscheinungen zunichte. Warum diese ganze Aufarbeitung? Weil es umso erstaunender ist, was nun passiert ist. Denn Eminems neues Album „Revival“ ist enttäuschend in allen Belangen, in seinen besten Momenten Durchschnitt.
Fangen wir mit dem Positiven an: Der Opener „Walk On Water“ präsentiert sich zwar kitschig, aber mit seinem reduzierten Klavier-Instrumental angenehm minimalistisch. Beyoncé singt wie gewohnt überragend und Em räumt sehr verletzlich mit dem Kult um seine Person auf: „I walk on water/But I aint no Jesus/I walk on water/But only when it freezes“. Trotzdem ungewöhnlich für jemanden, der sich vor einigen Jahren erfolgreich als „Rap God“ inszeniert hatte. Ansonsten gibt es leider nicht viel Gutes zu sagen. Die Schellen gegen Präsident Trump sind zwar lobenswert, wirken aber leider allzu hüftsteif und kriegen angesichts der Militär-Glorifizierung in seinem Freestyle angesichts der BET HipHop Awards einen mehr als faden Beigeschmack. Der Rest der 19 Songs ist langweilig bis unterirdisch: Das umstrittene Ed-Sheeran-Feature „River“ gerät gewohnt seelenlos radiotauglich, „Bad Husband“ beschäftigt sich mit den X Ambassadors unnötig pathetisch mit dem eigentlich offensichtlichen Umstand, nicht in jedem Lebensbereich glänzen zu können und „Believe“ will flowtechnisch innovativ sein, wirkt aber leider nur sperrig und unkoordiniert. Mittlerweile müssten eigentlich alle wissen, dass der Mann rappen kann – er selbst hat aber wohl immer noch nicht verstanden, dass es nicht auf technische Perfektion ankommt. Vom peinlichen Plattencover ganz zu schweigen.
Nicht unerwähnt bleiben darf der schreckliche Versuch, Rap-Rock wieder neu aufleben zu lassen. Man beachte, dass Eminem auf „The Real Slim Shady“ noch Limp-Bizkit-Frontmann Fred Durst gedisst hatte und nun auf Coversongs Musik von solcher Geschmacklosigkeit erschafft, die mit Worten nicht zu beschreiben ist. Der ehemalige Rap God unterlegt tatsächlich auf „Heat“ den Song „Feel My Heat“, auf „Remind Me“ Joan Jett`s „I Love Rock’n’Roll“ und auf „In Your Head“ zu allem Überfluss noch „Zombie“ von den Cranberries mit ein paar billigen Drums und seelenloser Produktion. Man fragt sich dazu, was die lebende Produzenten-Legende Rick Rubin dazu geritten hat, so etwas mitzumachen (oder gar zu initiieren?). Sogar 1998 wäre das scheiße gewesen.
Wertung
Aus einer theoretisch dankbaren Position – HipHop so erfolgreich und vielseitig wie noch nie und ein rassistischer Sexist im Weißen Haus – vergeigt es Eminem trotzdem in großem Stil. „Revival“ hat allerdings nichts mit künstlerischem Scheitern zu tun, sondern ist mit seiner seelenlosen Pop-Produktion und schrecklichem Rap-Rock-Revival einfach nur langweilig, peinlich und nicht selten fast schon überraschend unterirdisch, einige wenige nette Momente mal ausgenommen. Ansonsten beweist Marshall Mathers auf sage und schreibe 19 Songs und in 77 Minuten hieb- und stichfest seine Irrelevanz im HipHop anno 2017.
Wertung
Wow. Das war nix. Dass Eminem einen weiteren Schritt Richtung Massentauglichkeit geht, war abzusehen. Auf „Revival“ hat er nun aber sämtliche Ecken und Kanten wegpoliert und verkommt inmitten seiner hochkaratigen Gäste zum Besucher auf seiner eigenen netten Pop-Platte.
Julius Krämer
Julius stammt aus dem hoffnungslos unterschätzten Wuppertal und studiert momentan Musikpädagogik und Politikwissenschaft in Münster. Neben seiner Tätigkeit als Gitarrist in verschiedenen Bands begeistert ihn alles von Prog über Alternative bis Hardcore, er unternimmt aber auch gerne Ausfüge in HipHop, Jazz oder elektronische Musik und mag dabei besonders die Verarbeitung übergeordneter Gedankengänge oder des Zeitgeschehens in der Musik.